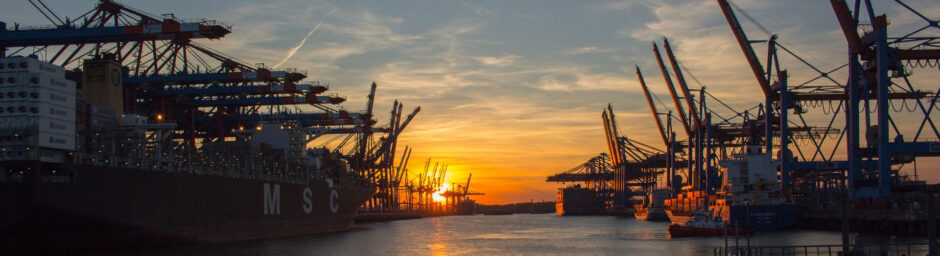Kennen Sie das auch: Sie surfen im Netz, browsen durch die Suchergebnisse auf Google und mit jedem Klick blinken neue Banner auf. Man bemerkt zwar, dass irgendetwas am Rande der Websites die Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte, aber meistens wehrt man sich doch gegen den Drang hinzusehen. Und wenn man doch kurz einen Blick darauf wirft, bleibt der Banner nicht allzu lange im Gedächtnis.
Kennen Sie das auch: Sie surfen im Netz, browsen durch die Suchergebnisse auf Google und mit jedem Klick blinken neue Banner auf. Man bemerkt zwar, dass irgendetwas am Rande der Websites die Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte, aber meistens wehrt man sich doch gegen den Drang hinzusehen. Und wenn man doch kurz einen Blick darauf wirft, bleibt der Banner nicht allzu lange im Gedächtnis.
Dr. phil. Martin Sauerland und Prof. Dr. Jarek Krajewski veröffentlichten 2012 eine Studie zum Thema Bannerblindness, in der die Autoren versuchen das Phänomen aus psychologischer Sicht zu beleuchten. Ihre Fragestellung bezieht sich darauf, aus welchen Gründen und auf welche Weise Rezipienten Bannerwerbungen im Netz ausblenden.
Als Grund sehen die Autoren vor allem die Marktsättigung in vielen Produktbereichen, welche die angebotenen Produkte austauschbar macht. Ein weiterer Grund ist die Flut von Werbeinformationen, denen ein Rezipient täglich ausgesetzt ist. Dadurch, so argumentieren Sauerland und Krajewski, würde es bei vielen Rezipienten zu einem „Information Overload“ kommen.
Die Autoren schlussfolgern, dass die Übermenge an Informationen zu einer „überpauschalisierten Abwehrhaltung auf Seiten der Verbraucher“ führe. Da die Aufmerksamkeitsressourcen der Verbraucher begrenzt sei, konzentrieren sich Rezipienten nur selten direkt auf Werbeinhalte, übersehen oder ignorieren sie oder bemühen sich sogar aktiv darum, sie zu meiden.
 So viel also zu dem „Warum“ der Frage. Aber wie finden diese Vermeidungsprozesse statt?
So viel also zu dem „Warum“ der Frage. Aber wie finden diese Vermeidungsprozesse statt?
Hier spielen sogenannte „Top-Down Prozesse der Informationsverarbeitung“ eine Rolle. Bei bestimmten Problemstellungen, beispielsweise einer gezielten Internetrecherche, werden kognitive Ressourcen aktiviert, die der Problemlösung zuträglich sind. Dadurch werden relevante Informationen (Worte oder Formen) beschleunigt wahrgenommen, während inkongruenten Reizen weniger, bzw. keine Bedeutung zugeschrieben wird. Diese Aufmerksamkeitsverteilung kann sowohl bewusst und auch automatisiert stattfinden.
Außerdem würde der Rezipient durch „präattentive Kategorisierung“ auch die weniger relevanten Informationen einer Webseite während kurzer „attention shifts“ bewerten. Da Werbung häufig über gewisse Grundcharakteristika verfügt, welche der Rezipient schnell zuordnen kann, könnte dieser die Werbung während eines kurzen „attention shifts“ bereits als irrelevant abtun und der Inhalt der Werbung würde keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Daher raten die Autoren auch dazu, vermehrt untypische Formen der Internetwerbung zu nutzen, wie beispielsweise dialogfeldartige Strukturen, die eine Interaktion mit dem Rezipienten ermöglichen.
Aber auch ohne viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, würde Bannerwerbung gewisse Effekte erzielen können, heißt es in der Studie weiter. Zu nennen sei hier, dass durch Konditionierung, ein positiver Assoziationsprozess zwischen den Grundcharakteristika (Farbe, Key Visual) des Werbebanners und dem Produkt entstehen könnte. Auch der „Mere Exposure Effekt“, welcher besagt, dass die mehrmalige Auseinandersetzung mit einem Reiz schon zu einer positiveren Bewertung beim Rezipienten führt, treffe in diesem Fall zu. Außerdem könnten unbewusste Lernprozesse stattfinden, die der Werbewirkung dienlich sind.
Wie groß die Effekte dieser Wirkungsformen letztendlich sind, ist jedoch noch unklar. Es ist also fraglich, ob noch von einer Werbewirkung im Sinne des Absenders auszugehen ist, wenn bei der Rezeption weder Produkt noch Marke Aufmerksamkeit geschenkt wird. Vielversprechender ist hier der Ansatz der beiden Autoren, neue Formen der Werbung zu entwickeln, welche der „präattentiven Kategorisierung“ entgegenwirken. Allerdings könnten auch diese Formen eines Tages aufgrund von Gewohnheitseffekten ihre Effektivität einbüßen.
Das beste Mittel gegen Bannerblindness wird somit der stete Einfallsreichtum der Werbebranche sein, den es braucht um Online-Werbung dauerhaft interessant zu gestalten.